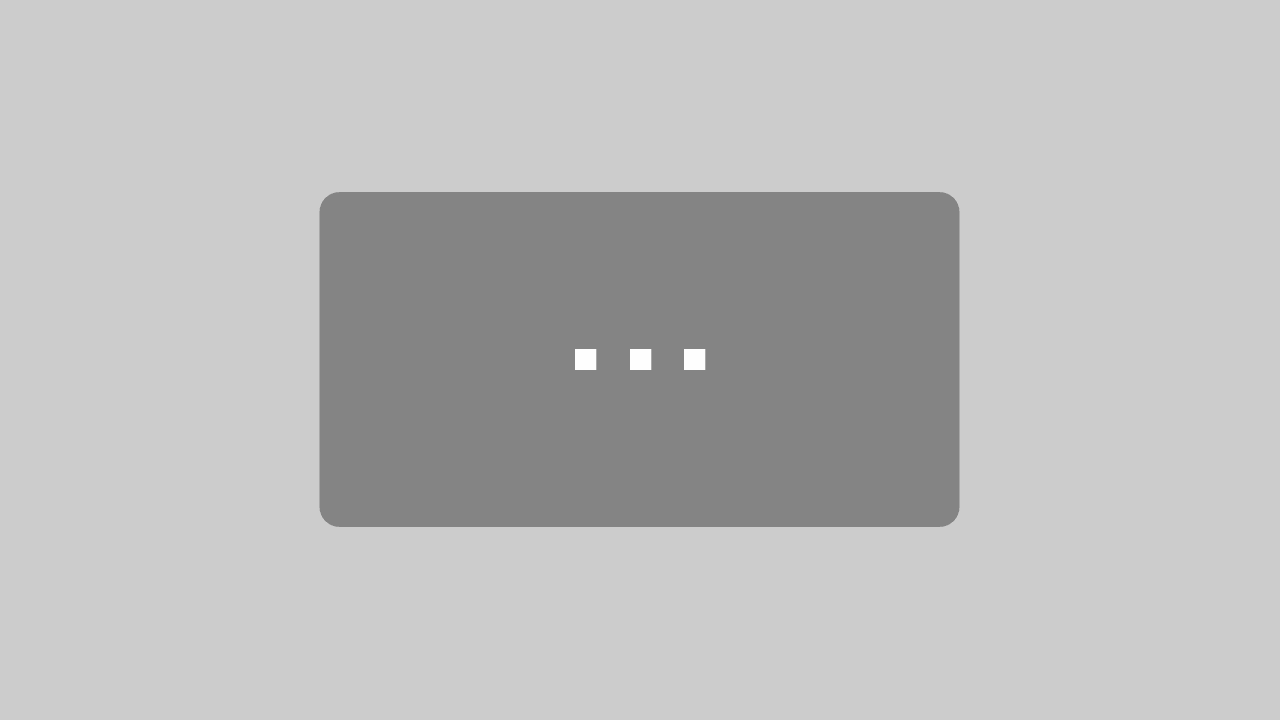„Klimawandel und urbaner Hitzestress: Wie können Städte der Zukunft begegnen?“ war das Thema des 11. „Umwelt im Gespräch“ am 28. Mai im Naturhistorischen Museum Wien (NHM). Auf dem Podium diskutierten der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, Gemeinderätin Nina Abrahamczik von der Stadt Wien, Umweltpsychologin Sabine Pahl (Co-Leiterin ECH, Universität Wien) und Umweltrechtswissenschaftlerin Stephanie Nitsch (ECH, Universität Wien) mit dem Publikum über Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen in Städten wie Wien. Gesundheits- und Umweltpsychologe Mathew White hielt den Impulsvortrag, Grußworte zur Einführung kamen von NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland und dem Rektor der Universität Wien Sebastian Schütze sowie vom ECH-Co-Leiter Thilo Hofmann. Über 200 Interessierte hatten sich in der beeindruckenden Kulisse der Kuppelhalle des NHM für das Event eingefunden.
Highlights der Veranstaltung im Video
Wissen schaffen, Wissen vermitteln und in den Dialog gehen
„Wir freuen uns, ein Ort des Austausches zu sein“, betonte Generaldirektorin Katrin Vohland in ihrer Begrüßungsrede als Hausherrin des Naturhistorischen Museums. Ihr liege viel an der „fruchtbaren Kooperation“ ihres Hauses mit dem Forschungsverbund Umwelt und Klima der Universität Wien und sie freue sich über die gemeinsame Vision „Wissen zu schaffen, Wissen zu vermitteln und in den Dialog mit der Gesellschaft zu gehen“.
„Das Thema Umwelt und Klima ist einer der großen strategischen Schwerpunkte der Universität Wien“, erklärte Rektor Sebastian Schütze, und die aktuellen Herausforderungen der Klima- und Umweltkrise könnten nur interdisziplinär gelöst werden. Dazu habe die Universität Wien alle Kompetenzen im eigenen Haus, so Schütze weiter, denn „um gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten, gibt es den Forschungsverbund Umwelt und Klima“. Das Event „Umwelt im Gespräch“ sei mittlerweile seit 2017 ein erfolgreich etabliertes Format für den Austausch zwischen Gesellschaft, Forschenden und Politik, dazu gratulierte Schütze dem Forschungsverbund Umwelt und Klima in seiner Rede.
Was zu tun ist – was nicht getan wird
Hitzewellen haben in Europa laut Nature Medicine im Jahr 2022 über 61.000 Todesopfer gefordert. Im Zeitraum 1960 bis 1990 gab es neun Hitzetage pro Jahr, heute sind es bereits mehrere Jahre mit über 30 Hitzetagen, Tendenz steigend. Durch Hitze sterben in Österreich mehr Menschen als im Straßenverkehr.
„Wir wissen doch eigentlich ziemlich genau, was die klimaresiliente Stadt von morgen benötigt, wie wir heute bauen müssten, um besser mit den Hitzewellen der Zukunft umgehen zu können – wir wissen doch, was zu tun ist und tun es nicht oder viel zu langsam“, stieg Gastgeber und Co-Leiter des ECH Thilo Hofmann direkt provokativ ins Thema ein und stellte seine Fragen ans Panel und das Publikum: „Reicht es, was wir tun? Müssen wir vielleicht sogar das Recht bemühen und den Staat verklagen, so wie in der Schweiz geschehen? Wie schaffen wir es, unser Verhalten dauerhaft zu verändern, Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen, Ängste zu nehmen?” Wie komplex das Thema des Abends war, machten die Antworten des Panels und die folgenden Diskussionen mit dem engagierten Publikum deutlich.
Klimakrise und ihre gesundheitlichen Herausforderungen
Zunächst gab Gesundheits- und Umweltpsychologe Mathew White (ECH, Universität Wien) mit seinem Impulsvortrag zum Thema „Urbane Natur, Gesundheit und Klimawandel“ einen Überblick über die gesundheitlichen Herausforderungen, vor die der Klimawandel Städte wie Wien stellt. Den Auswirkungen von Hitzewellen und Extremwetterereignissen müsse und könne man entgegenwirken, erklärte White und skizzierte mögliche Lösungsansätze für Städte: Mehr Begrünung, Flächenentsiegelung, Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu den sogenannten „grünen und blauen Erholungsflächen“. Diese Maßnahmen würden Möglichkeiten zur gesunden Freizeitgestaltung in der Stadt schaffen. Ziel müsse also sein, Städte inklusiv, sicher, resilient und nachhaltig zu gestalten, so dass alle Bewohner*innen gleichermaßen Zugang zu Orten für Bewegung, Erholung und sozialen Austausch finden könnten. Daran, so White, kranke es noch, denn gerade ärmere Bevölkerungsschichten hätten deutlich weniger Zugang zu innerstädtischen Erholungsräumen. Vor allem diese Menschen würden von der Zugänglichkeit solcher Orte profitieren – eine Entwicklung, die wiederum das gesamte soziale Gefüge der Stadt entlasten könne.
Klimakrise als soziale und ökonomische Krise
„Die Klimakrise zeigt uns sehr deutlich die Schwächen unserer Gesellschaft“, brachte es Hans-Peter Hutter auf den Punkt, “nämlich die Auswirkungen von Anonymität und mangelnder Solidarität”, so der Umweltmediziner weiter, der an der Medizinischen Universität Wien zu gesundheitlichen Risiken von Hitzestress forscht. Die Hitzeproblematik müsse ernster genommen werden und könne nicht von der sozialen Problematik getrennt werden, konstatierte Hutter, es gäbe noch großen Aufklärungsbedarf bei bildungsfernen Schichten, die in schlecht hitzegeschützten Bereichen wohnten und oft nicht wüssten, wie sie mit Hitze umgehen müssen. „Gerade ärmere Menschen, Alte, Kranke, Kinder oder Schwangere haben keine Lobby und wir dürfen sie in dieser Anpassungsphase nicht vergessen“, so Hutters eindringlicher Appell an Gesellschaft und Politik.
Grüne Oasen für alle
Zu häufig würden prominente Einkaufsstraßen in der Stadt begrünt, während einkommensschwächere Grätzel vergessen werden, so die Feststellung aus dem Publikum und Frage an Gemeinderätin Nina Abrahamczik nach der gerechten Verteilung von „Begrünungsaktivitäten“. Es sei aktuell eine große Herausforderung, so viel wie möglich und so schnell wie möglich umzusetzen, so die Antwort, „doch oft sind Entscheidungsprozesse für Bewohner*innen nicht immer nachzuvollziehen“, daher sei ihr ein partizipativer Ansatz in der Stadtplanung und Austausch mit den Menschen vor Ort „enorm wichtig“, um Ängsten und Ablehnung besser begegnen zu können. Abrahamczik betonte auch, dass Klimafragen nicht nur auf individueller Ebene zu lösen seien, sondern dass die Politik dafür Strukturen und Rahmenbedingungen schaffen müsse. „Erst wenn die Infrastruktur gut ist, werden die Bewohner*innen die Öffis nutzen“ und „die Menschen müssen erst einmal finanziell abgesichert sein, damit sie sich überhaupt klimafreundlich verhalten könnten“, so die Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal der Stadt Wien weiter.
Gesundheit und Menschenrechte
„Verhaltensänderung braucht Zeit“, so Umweltpsychologin Sabine Pahl (Co-Leiterin ECH, Universität Wien) in der Diskussion, „und diese Zeit haben wir eigentlich nicht mehr“. Aus psychologischer Sicht sei es daher sinnvoll, mehr über die Gesundheitsaspekte der Klimakrise zu sprechen, um Menschen in unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen. „’Wie geht’s der Oma zuhause?’ ist eine wichtige Frage, erklärte Pahl, denn wenn der eigene Körper, die Kinder oder Großeltern betroffen seien, falle die Entscheidung für eine Verhaltensänderung leichter und es sei mehr Verständnis für Klimamaßnahmen da, so Pahl weiter.
Dass aber auch Staaten in Sachen Klimaschutz Pflichten zum Schutz ihrer Bürger*innen zu erfüllen haben, machte eine Frage aus dem Publikum zur erfolgreichen Klage der „KlimaSeniorinnen Schweiz“ an Umweltrechtswissenschafterin Stephanie Nitsch (ECH, Universität Wien) auf dem Panel deutlich. Die KlimaSeniorinnen hatten in ihrer Klage der Schweiz vorgeworfen, Menschenrechte älterer Frauen zu verletzen, weil sie nicht das Nötige gegen die fortschreitende Klimaerwärmung tut, die jedoch überproportional Ältere und Frauen betrifft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gab der Klage statt und schuf damit einen Präzedenzfall für alle 46 Staaten des Europarates. Ob dieses Urteil eine Auswirkung auf Österreich haben könne, wollte die Fragestellerin wissen – „das wird es definitiv“, erklärte Nitsch, „es wird vielleicht nicht die nächste Klimaklage mit den gleichen Argumenten vorgebracht, aber die Rechtsgrundlagen sind hier bei uns dieselben“.
Zum Abschluss der lebhaften Diskussion fasste Thilo Hofmann die Kernpunkte noch einmal zusammen und gab einen Ausblick auf das Thema des nächsten „Umwelt im Gespräch“ am 8. Oktober: „Schnee war gestern – Klimawandel in den Alpen“.
Moderation: Marlene Nowotny
Graphic Recording: Kathrin Gusenbauer, Irrlicht-Impressions
Nachbericht von Nora Gau (ECH-Redaktionsleitung)
Videos
- Hitzeaktionsplan der Stadt Wien
- Hitze in Städten nimmt zu: Wie man sie erträglich macht – Standard Artikel mit Kerstin Krellenberg
- Hitzesommer: Gesundheitliche Belastung in Städten ungleich verteilt – APA-Meldung
- Herausforderung Klimakrise und Städte – Interview in der Rudolphina mit Kerstin Krellenberg
- Städte in Zeiten der Klimakrise – ein Artikel von Thilo Hofmann
- Forschungsstelle für Umweltrecht
- Green and Tempting? Combatting Greenwashing in Consumer Marketing – ein wissenschaftlicher Artikel von Stephanie Nitsch